
Die Vortragenden vom 1. Oktober 2008
Professor Dr. phil. Dieter Birnbacher Flyer
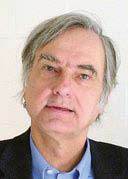
geboren am 21.11.1946 in Dortmund
-
1966 - 1973 Studium der Philosophie, der Anglistik und der Allgemeinen Sprachwissenschaft in Düsseldorf, Cambridge und Hamburg
-
1973 Promotion Hamburg
-
1978 Akademischer Rat
-
1974 - 1985 Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Umwelt Gesellschaft Energie an der Universität Gesamthochschule Essen (Leitung: Klaus Michael Meyer-Abich)
-
1988 Habilitation (Essen)
-
1993 Professor für Philosophie an der Universität Dortmund
-
1996 Professor für Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Forschungsschwerpunkte
-
Ethische und anthropologische Grundlagen- und Anwendungsprobleme der modernen Medizin: Organtransplantation, Reproduktionsmedizin, Sterbehilfe, Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitssystem, Stammzellforschung, Gentechnik.
-
Ethische Probleme im Spannungsfeld von Transhumanismus und Biokonservativismus: Inwieweit dürfen und sollen wir die Natur des Menschen verändern? Hat die Unterscheidung von Künstlichkeit und Natürlichkeit ethisches Gewicht?
-
Anthropologie und Neurophilosophie: Probleme des Epiphänomenalismus. Emotionstheorien.
-
Schopenhauerforschung.
Kernaussagen
Religiöse Überzeugungen, Einstellungen und Gefühle sind eine wichtige Motivationsquelle für die Moral. Als Begründungen, oder als Kriterien dafür, welche moralischen Grundsätze richtig und angemessen sind, sind die meisten religiösen Glaubenssysteme (vor allem die theistischen) aus theoretischen wie pragmatischen Gründen nicht geeignet. Das theoretische Problem besteht darin, dass jeder Versuch, moralische Normen mit Berufung auf den Willen Gottes oder die Aussagen heiliger Schriften zu gründen, in einen logischen Zirkel führt, da angesichts der Unbestimmtheit und Auslegungsoffenheit der “Offenbarung” für eine verbindliche Auslegung bereits moralische Kriterien in Anspruch genommen werden müssen. Auch dann, wenn sich ein göttlicher Wille eindeutig ermitteln ließe, stellte sich für eine religiöse Ethik dieselbe Frage wie für alle anderen obersten Prinzipien: die Frage nach unabhängigen Gründen für ihre Autorität. Das pragmatische Problem besteht darin, dass sich diese Frage bei einer religiösen Ethik schärfer stellt als bei Vernunftethiken, vor allem wegen der geringeren Aussichten, für die Anerkennung der jeweiligen Normautorität einen Konsens zu erreichen.